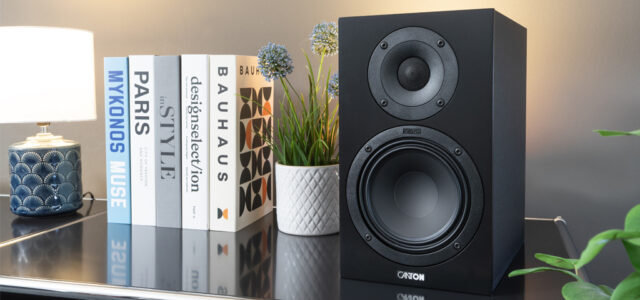Home » Heimkino » Hat öffentlich-rechtliches Fernsehen eigentlich noch eine Daseinsberechtigung?
16. Juli 2021WERBUNG | Es waren einige für die deutsche Fernsehlandschaft überraschende Meldungen, die in jüngster Zeit durch die Presse gingen: Tagesthemen-Moderatorin Pinar Atalay wechselt zu RTL und folgt damit unter anderem Jan Hofer. Vornehmlich deshalb, weil der Sender und eigentlich generell das Privatfernsehen eine Nachrichtenoffensive plant.
Und nicht zuletzt, wenn wieder die Abrechnung des Rundfunkbeitrags im Briefkasten liegt, entsteht auch bei vielen Ärger: Warum für etwas gutes Geld (aktuell immerhin 17,50 Euro monatlich) bezahlen, was in Zeiten von Smart-TVs und immer umfangreicher werdenden Streaming-Anbietern von immer weniger Menschen wirklich angeschaut wird? Eine zugegeben gute Frage. Allerdings gibt es durchaus Argumente, warum öffentlich-rechtlicher Rundfunk gerade in der heutigen Zeit noch eine Daseinsberechtigung hat.

ARD und ZDF stehen sinnbildlich für Deutschlands öfentlich-rechtlichen Rundfunk (Foto: pixabay.com/MichaelGaida).
1. Eine grundsätzliche, für alle erreichbare Basisversorgung
Wie empfangen wir heute Fernsehen? Neben dem auch dafür immer wichtiger werdenden Internet, läuft alles letztlich auf drei digitale Arten heraus:
– Terrestrischer Funk (DVB-T2),
– Satellitenfunk (DVB-S2) und
– Kabelfernsehen (DVB-C).
Auch wenn wir uns alle daran gewöhnt haben, so ist es zumindest aus bürgerrechtlicher Sicht ein Problem, dass immer mehr Programme der privaten Sorte hinter irgendwelchen Zahlungsmodellen verschwinden. Selbst wenn es vornehmlich (noch) nur solche in HD-Bildqualität sind.
An diesem Punkt muss man sich die Aufgaben eines modernen Staates aus Sicht der Informationsbereitstellung visualisieren: Ebenso wie er gewährleisten muss, dass jeder Zugang zu einer Basis-Gesundheitsversorgung, zu sauberem Wasser etc. hat, gilt dies auch für Informationen.
Das ergeht strenggenommen sogar aus Artikel 5 des Grundgesetzes und wurde auch schon richterlich genauso bestätigt:
„[…] die essenziellen Funktionen des Rundfunks für die demokratische
Ordnung ebenso wie für das kulturelle Leben in der Bundesrepublik. Darin finden der öffentlich-rechtliche Rundfunk und seine besondere Eigenart ihre Rechtfertigung.“
Das heißt, der Staat muss gewährleisten, dass es eine mediale Grundversorgung gibt, auf die jeder Zugriff hat, der ein entsprechendes Gerät besitzt. Das mag manchen nebensächlich erscheinen, jedoch wäre es ohne diesen Zwang möglich, dass die Medienwelt nur von einigen großen Imperien betrieben wird – Imperien mit anderen Interessen als die Information der Zuschauer.
2. Liefern regionaler Informationen
Deutschland ist ein verhältnismäßig kleines Land, was seine Fläche anbelangt. Dennoch gibt es auch hier große Unterschiede, was die Interessenlage in geographischer Hinsicht anbelangt. Für die großen, überregional agierenden Sender ist deshalb nur das von Relevanz, was auch ein überregionales Publikum interessiert. Umgekehrt ist es für sehr regionale Privatsender unglaublich schwer, wirtschaftlichen Erfolg zu haben. Hier wirkt es sich aus, dass vor allem im ländlichen Raum nicht genügend werberelevante Zuschauer existieren – wodurch die Sender es schwer haben, sich über Werbung zu finanzieren. Dies ist zwar kein Argument für ARD und ZDF, wohl aber für die Dritten. Diese können durch die Finanzierung über den Rundfunkbeitrag ein geographisch klar abgegrenztes Programm produzieren – mit Inhalten, die vielleicht nicht jeden Bundesbürger interessieren, wohl aber die Einwohner einer Region.
3. Übertragung weniger werberelevanter Nischen
Wer einen wirklich guten Grund sucht, warum ARD und ZDF existieren, der sollte sich fragen, was er heute alles tun muss, um Profifußball zu sehen – ohne Sky und DAZN geht es nicht mehr. Und es gibt auch nur eine Radiosender-Art, bei der noch ganz klassisch Spiele live übertragen werden. Dass wir die Fußball-EM im ÖR-TV sehen konnten, liegt nur daran, dass die Sender viel Geld dafür bezahlt haben – dennoch mussten sie einen Teil der Spiele exklusiv an Magenta TV abgeben. Für die Zukunft rechnet man sogar damit, dass noch mehr große Spiele hinter die Paywall wandern werden. Noch mehr wird nur durch die Tatsache verhindert, dass es in Deutschland Gesetze gibt, die vorschreiben, dass Olympische Spiele, Fußballspiele der deutschen Nationalelf sowie Halbfinal- und Finalspiele von Fußball-EMs und -WMs frei empfangbar sein müssen.
Der Grund für diese Kosten liegt in der Vergangenheit. Und tatsächlich geht das Problem noch tiefer in eine generelle Wechselwirkung von Sport und Privat-TV: Erst die dort erschließbaren Gelder konnten daraus jene Milliardenindustrie machen, die sie heute ist. Mit allen Vor- und Nachteilen und dass sich die ÖR-Sender die gigantischen Übertragungsrechte nicht mehr leisten können (hier kommt hinzu, dass die angesprochene Grundversorgung ein breites Spektrum abdecken muss, sich also nicht beispielsweise nur auf Nachrichten und Fußball beschränken darf).
Das Problem ist nur: Sport ist so viel mehr als Fußball. Nur darf sich der geneigte Leser die Frage stellen, wo er Leichtathletik, Radrennen, Schwimmen und Ähnliches sehen würde, wenn nicht die Öffentlich-Rechtlichen übertragen würden. Wer nun auf Privatsender tippt, liegt falsch. Dafür können viele Sportarten einfach zu wenige werberelevante Zuschauer mobilisieren – und was nicht werberelevant ist, wird nicht gezeigt. In einem Deutschland ohne ÖR-TV würden deshalb wohl nicht nur viele Sportarten entweder hinter teuren Paywalls verschwinden oder gar nicht mehr gezeigt. Wessen Sport bzw. Interessengebiet nicht betroffen ist, dem mag das egal sein, für viele wäre es jedoch sehr nachteilig.

Es muss den ÖR-Rundfunk geben, weil sonst niemand die Debatten des Bundestages übertragen würde (Foto: pixabay.com/kschneider2991).
4. Eine zumindest grundsätzlich unabhängige Berichterstattung
Wer in Deutschland ein Dach über dem Kopf hat, muss Rundfunkbeitrag entrichten. Das mag so manchen wütend machen, sollte aber auch zum Nachdenken anregen. Eben wurden bereits Medienimperien angesprochen. Obwohl diese ebenfalls einer journalistischen Sorgfaltspflicht unterliegen, ist es eben doch eine Tatsache, dass hier wirtschaftliche Interessen den offensichtlich wichtigsten Stellenwert haben. Das könnte durchaus dazu führen, dass sich die Berichterstattung unterschiedlicher Privatsender entlang von Parteilinien oder ähnlichen Interessen gestaltet. Würde etwa ein Sender hart und investigativ gegen ein Unternehmen berichten, das erst kürzlich bei ihm Werbung in Millionenhöhe gebucht hat?
Nun steht der ÖR-Rundfunk nicht erst seit jüngster Zeit in der Kritik, eine Art „Staatsfunk“ zu sein, der zumindest gegenüber der jeweils aktuellen Bundesregierung nicht allzu kritisch vorgeht. Und es ist zumindest auch stellenweise erwiesen, dass die Corona-Berichterstattung etwas einseitig war. Daraus aber abzuleiten, dass ÖR-Rundfunk generell nur ein Lautsprecher der Politik sei, wäre völlig überzogen:
– ÖR-Rundfunk erhält keinen einzigen Cent aus den Steuertöpfen; er ist finanziell komplett von öffentlichen Haushalten entkoppelt. Nur die Deutsche Welle als Auslandssender wird mit Steuermitteln finanziert.
– Der ÖR steht über Aufsichtsgremien unter ständiger öffentlicher Kontrolle.
– Aus dem Rundfunkstaatsvertrag geht keine Pflicht zu bedingungsloser Neutralität hervor, sondern „nur“ die Pflicht zu einer ausgewogenen, nicht tendenziösen Berichterstattung.
Das soll definitiv nicht bedeuten, dass ÖR-Rundfunk perfekt sei, das ist er sicherlich nicht. Berechtigt ist vor allem die Frage, ob es wirklich zwei große Vollprogrammsender, neun Landessender und 74 Radiosender braucht – neben den Internetdienstleistungen. Hier scheint es durchaus kritikwürdig, dass ein so großes Konstrukt durch hohe Gebühren finanziert werden muss. Dieser Kritik können sich die öffentlich-rechtlichen Sender auch nicht entziehen. Deshalb forderte nicht zuletzt die Mittelstandsvereinigung der Unionsparteien jüngst, ARD und ZDF zusammenzulegen; mittel- bis langfristig wird sich dies kaum vermeiden lassen. Auch lässt sich sicherlich diskutieren, ob es nicht besser wäre, die Inhalte der Grundversorgung auf mehr Information zurückzuschneiden und dafür auf Unterhaltungssendungen zu verzichten, die kaum Einschaltquoten generieren – womit definitiv nicht nur Liebesschnulzen gemeint sind.
Das alles darf aber nicht dazu führen den ÖR-Rundfunk generell als parteiisch abzutun. Damit würde sowohl dem Prinzip wie der Realität unrecht getan. Wer wissen möchte, wie ein Land ohne nennenswerten ÖR aussieht, kann in die USA blicken, wo die angesprochenen Medienimperien mit ihren politischen Lagern alles in ihrer Hand haben.
5. Transparentmachung der politischen Mechanismen
Ist Politik unterhaltsam? Nun, in den meisten Fällen wohl eher nicht. Das ist auch der Grund, warum nur recht wenige Zuschauer den ÖR-Sender Phoenix einschalten. Er überträgt unter anderem auch Bundestagssitzungen und Parteitage. Nur sollte auch hier das für viele uninteressante Thema nicht darüber hinwegtäuschen, wie unsagbar wichtig die Rolle des ÖR ist. Kein Privatsender würde Bundestagsdebatten ungeschnitten in voller Länge übertragen. Und längst nicht jeder hat die Möglichkeiten, diese ersatzweise zu streamen.
Das Ergebnis wäre tatsächlich undemokratisch: Die politischen Prozesse würden hinter den Mauern der Parlamente verschwinden. Jeder Bürger wäre darauf angewiesen, sich auf das zu verlassen, was private Medien daraus für ihn aufbereiten. Das darf selbst diejenigen nicht kalt lassen, die niemals ÖR-TV einschalten und nur Privatradio hören. In einem demokratischen Land muss es eine Institution geben, die bei solchen Prozessen ungefiltert überträgt. Selbst wenn man sich das nicht anschaut, so muss es doch zumindest das Angebot geben. Ganz ähnlich wie Wahlen selbst. Auch daran nimmt nicht jeder teil, jedoch profitiert wirklich jeder davon, dass es sie gibt.