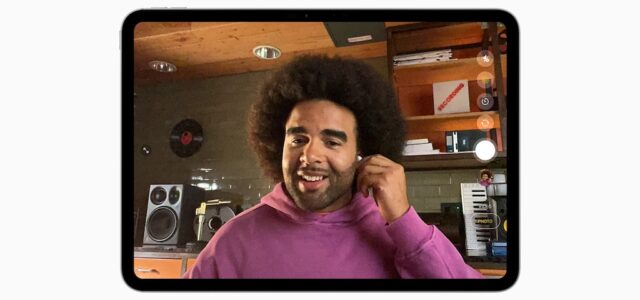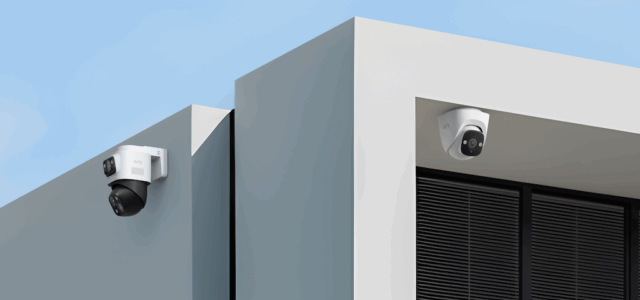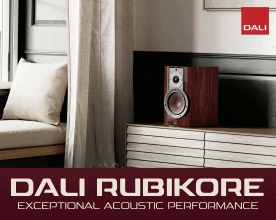Home » Tests » AudioQuest Niagara 3000 – Strommanagement-System für Anspruchsvolle
22. Juli 2024
von Jonas Bednarz
RedakteurStrommanagement ist in der Audiobranche in aller Munde und mit dem Niagara 3000 bietet AudioQuest einen Power Conditioner an, der sich an anspruchsvolle Hörer mit hochwertigen Audio-Anlagen richtet. Zeit für einen Praxistest.

Der Niagara 3000 reiht sich über dem kompakten 1300 und den beiden größeren Modellen 5000 und 7000 ein.
Zwei Faktoren haben wohl dazu geführt, dass Strommanagement-Geräte immer beliebter werden: HiFi-Geräte sind immer besser geworden und machen heute auch feinste Details und Klangnuancen hörbar. Gleichzeitig wird das Stromnetz durch die zunehmende Anzahl der angeschlossenen Geräte immer weiter verunreinigt. Diese Entwicklungen hat der amerikanische Zubehörspezialist AudioQuest zum Anlass genommen zusätzlich zu Signal- und Netzkabeln auch eine hochwertige Serie an Strommanagement-Geräten zu entwickeln. AudioQuest geht argumentativ sogar noch etwas weiter und sagt, das Wechselstromnetz sei nur für simpelste Geräte wie Glühlampen entstanden und für Audio-Anwendungen ziemlich ungeeignet. Da wir dennoch damit leben müssen, ist die Niagara-Serie entstanden, aktuell bestehend aus vier Geräten. Den kleinsten Niagara 1200 hatten wir bereits im Test und sind davon sehr positiv beeindruckt. Nun folgt der nächstgrößere Niagara 3000, der ein spannendes weiteres Feature mitbringt. Entsprechend hoch sind also Vorfreude und Erwartungen an die Performance des AudioQuest Niagara 3000.
Ein bisschen Elektrotechnik
Der Wechselstrom in unseren Stromnetzen hat einige Vorteile: Er lässt sich zum Beispiel leicht über weite Strecken transportieren, ohne dass es dabei zu exorbitanten Verlusten kommt. Wir brauchen also nicht alle ein eigenes Kraftwerk im Keller, sondern können bequem große Kraftwerke außerhalb der eigenen Sichtweite betreiben. Gleichzeitig lässt sich die Höhe der Wechselspannung unkompliziert über Transformatoren hinauf- oder herabsetzen. Mit Gleichspannung ginge das nicht so einfach. Für viele Anwendungen ist es zudem ziemlich egal, ob die Geräte mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden. Oft ist sogar auch in dieser Disziplin die Wechselspannung im Vorteil. Allerdings verursachen viele am Stromnetz angeschlossene Geräte Störungen, die sich im Wechselspannungsnetz leicht ausbreiten können. Für den Betrieb komplexer Audio- oder Videogeräte ist die Wechselspannung aus der Steckdose zudem gänzlich ungeeignet. Darum wird in jedem Gerät zuerst eine Gleichspannung erzeugt, welche dann für die eigentlichen Prozesse der Geräte genutzt wird.

Das Design von Power Conditionern ist üblicherweise eher zurückhaltend und auch der 3000 spielt sich nicht in den Vordergrund. Dennoch verlieh AudioQuest dem Niagara ein elegantes Design und hochwertige Verarbeitung. So passt er gut zu anderen Premium-Komponenten.
Verschmutzter Strom
Die Störungen im Stromnetz kennen viele Leser zum Beispiel als das charakteristische Geräusch aus den Lautsprechern, wenn ein Anruf am Mobiltelefon ankam. Seit der Umstellung auf UMTS gibt es diese Störung im hörbaren Bereich zwar nicht mehr, verschwunden sind solche elektromagnetischen Unverträglichkeiten jedoch nicht. Auch Motoren in Haartrocknern, Kompressoren in Kühlschränken und der Schaltimpuls in Lichtschaltern verursachen ähnliche Effekte, die oft jedoch nicht so direkt hörbar sind. Dennoch wirken sie sich insgesamt auf den Klang der Anlage aus. So jedenfalls die Argumentation der Hersteller von Stromaufbereitern, Netzfiltern, Power Conditionern und ähnlicher Geräte. Auch wir stellen immer wieder fest, dass es mit einer hochwertigen Stromversorgung besser klingt. Vermutlich haben auch sie schon mal die Erfahrung gemacht, dass ihre eigene HiFi-Anlage an manchen Tagen besser klingt. Das kann natürlich psychoakustische Gründe haben, an physikalischen Parametern wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit liegen, oder eben an der Qualität der Netzspannung.
Klangverbesserung ist nicht das Ziel
Um den Einfluss der wechselnden Qualität der Netzspannung möglichst auszuschließen und den Audiogeräten genau die Stromqualität zu liefern, die sie für die optimale Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen, hat AudioQuest die Niagara-Serie entwickelt. Bei den Geräten der Niagara-Serie handelt es sich um Netzfilter beziehungsweise Power Conditioner, die man sicher auch Strommanagement-Geräte nennen könnte. Sie versuchen den negativen Einfluss der unvollkommenen Netzspannung zu minimieren und damit unseren HiFi-Geräten Raum zur freien Entfaltung zu lassen. Es geht hier also nicht darum, den Klang der Geräte zu verbessern. Stattdessen soll durch das Strommanagement die Performance der Geräte „nur“ nicht mehr eingeschränkt werden. Wir hören die HiFi-Anlage also mit ihrem maximalen Potenzial und nicht mit angezogener Handbremse durch Verunreinigungen in der Energiequelle. Dafür verfügen die Geräte über eine Reihe von Funktionen, die unterschiedliche Probleme adressieren und beseitigen sollen. Diese Features sehen wir uns nun einmal genauer an.

Der Niagara soll kein „Klangverbesserer“ sein. Vielmehr schafft er die Voraussetzungen, um andere Geräte ihr volles Potenzial ausschöpfen zu lassen.
Massive Netzleiste
Die offensichtlichste und auch irgendwie wichtigste Funktion des AudioQuest Niagara 3000 ist die Verteilung des Steckdosenstroms auf die angeschlossenen Geräte. Damit erfüllt er die Funktion einer Mehrfachsteckdose. Eine teuere Mehrfachsteckdose, zugegeben, jedoch auch eine sehr hochwertige. Sieben Geräte lassen sich auf diese Weise mit Energie versorgen. Das smarte am Niagara 3000 ist dabei der Hauptschalter auf der Front, mit dem sich alle Geräte gleichzeitig einschalten lassen, was durch die Power-LED ebenda auch angezeigt wird. Ich betreibe Aktivlautsprecher an einem Gerätepark von fünf Geräten, müsste also sieben Schalter betätigen, um die Anlage in Betrieb zu nehmen, oder eben den einen Hauptschalter des Niagara 3000 umlegen und fertig. Das spart, hochgerechnet auf die jahrelange Betriebszeit der Anlage, sicher einige Sekunden Lebenszeit. Quatsch, dieser Effekt ist natürlich zu vernachlässigen! Viel wichtiger ist aber: Es ist einfach saubequem so. Smart ist auch, dass alle angeschlossenen Geräte vor Überspannung geschützt sind.

Mit dem Kippschlater an der Front lassen sich alle angeschlossenen Systeme gesammelt einschalten.
Gut abgesichert
Damit sind wir schon bei einem weiteren sinnvollen Feature: Der Niagara 3000 verfügt über einen wartungsfreien Überspannungsschutz, der alle angeschlossenen Geräte im Fall eines Blitzschlags, oder auch im Falle anderer, weniger gravierender Fälle von Überspannung und Überstrom bis 6.000 Volt und 3.000 Ampere absichert. Dazu werden die Geräte komplett vom Netz getrennt. Nach dem Ereignis heilt sich die Schaltung von selbst und ist nach einer kurzen Erholungsphase wieder Einsatzbereit. Über das Auslösen dieser Funktion gibt die zweite LED auf der Front Auskunft. Leuchtet sie, sind die Geräte vom Netz getrennt, erlischt sie wieder, ist das Ereignis vorüber und die Selbstheilung abgeschlossen. Wer sich das Gerät genau ansieht, entdeckt auf der Rückseite noch einen massiven Schalter. Dieser erfüllt irgendwie auch eine Art Sicherheitsfunktion: Er setzt die „Transient Power Correction“ außer Betrieb. Hierfür kann es zwei Gründe geben. Einen nachvollziehbaren und einen weniger einleuchtenden.

Die rote LED weißt auf den Überspannungsschutz hin. Wurde die Schutzschaltung aktiviert, erholt sich der Niagara nach einigen Minuten wieder von selbst.
Leistungsspitzenkorrektur
Bei der Leistungsspitzenkorrektur handelt es sich um ein Kernelement des Niagara 3000: eine Puffer-Funktion, die den angeschlossenen Geräten kurzfristig hohe Stromimpulse bereitstellen kann. Die Funktion abzuschalten kann ein sinnvoller Ansatz sein, wenn die angeschlossenen Geräte brummen. Dann könnte sich ein zu hoher Anteil harmonischer Verzerrungen im Stromnetz befinden, sagt die Anleitung. Dies sei jedoch eine Ausnahme und ich konnte einen solchen Fall im Test auch nicht beobachten. Der wichtigere Grund für die Abschaltbarkeit der „Transient Power Correction“ liegt in einer elektrotechnischen Besonderheit dieser Funktion, die grundsätzlich unschädlich ist, einige Kunden in der Vergangenheit jedoch wohl verunsichert hat. Deshalb hat man sich dazu entschieden, die Funktion abschaltbar zu gestalten. Wer es genau wissen will, die Power Correction nimmt durch Phasenverschiebung eine recht hohe Blindleistung auf, die mit Messgeräten zwar Messbar ist, aber sich nicht auf den abgerechneten Stromverbrauch auswirkt. Daher lautet die Empfehlung klar, die Funktion aktiviert zu lassen.
Aufteilung der Anschlüsse
Die Pufferfunktion steht, wenn sie wie empfohlen eingeschaltet ist, den ersten beiden Anschlüssen zur Verfügung. An diesen High-Current/Low-Z Power Steckplätzen sollten also stromhungrige Geräte wie Leistungsverstärker, oder, wie in meinem Fall, Aktiv-Lautsprecher angeschlossen werden. Diese bekommen dann unkomprimierte Leistung mit Stromstärken bis zu 55 Ampere zur Verfügung gestellt. Die anderen fünf Anschlüsse dienen Geräten mit eher niedriger, dafür aber konstanterer Stromaufnahme. Das können Vorstufen, Phonoverstärker, CD-Player, Steamer, Plattenspieler und so weiter sein. In welcher Reihenfolge diese angeschlossen werden sollen, entscheiden am besten die Ohren, sagt AudioQuest. Das ausführliche, leider nur englischsprachige Manual, macht aber Vorschläge. Diese fünf Steckplätze sind mit der von AudioQuest entwickelten Filtertechnologie „Lineare Noise-Dissipation-Technologie Klasse X“ ausgestattet. Hinter dem griffigen Namen verbirgt sich eine Technik die leicht erklärt aber detailliert schwer zu verstehen und noch schwieriger zu entwickeln ist: Im Grund handelt es sich um ein Tiefpassfilter, der tieffrequenten Wechselstrom passieren lässt.

Die insgesamt sieben Anschlüsse des 3000 sind in zwei Gruppen aufgeteilt. Zwei Buchsen versorgen besonders stromhungrige Geräte, während die übrigen fünf sich besonders für Quellgeräte eignen.
AudioQuest Niagara 3000 – Sauberer Strom für klaren Klang
Die Filterung lässt also den erwünschten 50 Hertz-Wechselstrom passieren, stellt für höhere Frequenzen jedoch eine deutliche Hürde von 24 Dezibel dar, was ungefähr einem Faktor von 16 entspricht. Das Besondere daran ist nun, dass die Schaltung einen breitbandigen Bereich von 10 Kilohertz bis 1 Gigahertz abdeckt. Hierauf ist man bei AudioQuest besonders stolz, denn die Entwicklung hat einige Zeit in Anspruch genommen. Lohn der Mühe ist, dass durch die breitbandige Filterung besonders viele der Störungen in der Netzspannung eliminiert werden sollen. Sowohl solche durch angeschlossene Geräte, als auch Funkeinstreuungen durch Mobilfunk und WLAN. Besonders die empfindlichen Geräte wie Vorverstärker und Phonostufen sollten daher besonders vom Anschluss an der gefilterten Stromversorgung profitieren. Über die dritte Schlüsseltechnologie des AudioQuest Niagara 3000 freuen sich dann wieder alle sieben Ausgänge: Das Ground-Noise-Dissipation-System zur Ableitung von Grundrauschen auf Neutral- beziehungsweise Schutzleiter.
Dreistufige Ground-Noise-Dissipation
Wie genau das dreistufige Ground-Noise-Dissipation-System funktioniert vermag ich auch nicht zu erklären. Es gibt jedoch eine ausführliche wissenschaftliche Abhandlung in englischer Sprache dazu, in der jeder selbst nachlesen kann. Für Anwender ist wohl in erster Linie wichtig, dass alle sieben Anschlüsse über diese Technik verfügen – und zwar in drei Gruppen: Die Hochstrom-Ausgänge sind Gruppe eins, die Ausgänge drei und vier sind Gruppe zwei und die verbleibenden Ausgänge fünf bis sieben sind die letzte Gruppe. Die jeweiligen Gruppen sind voneinander isoliert und so wird auch deutlich, warum es sinnvoll sein kann, die Anschlussreihenfolge der Geräte an den Ausgängen drei bis sieben zu verändern: Dadurch schafft man verschiedene Gruppenkostellationen, die sich positiv auf den Klang auswirken können sollen. Dass muss dann jeder für sich ausprobieren. Ein Ansatz wäre zum Beispiel, digitale und analoge Geräte voneinander zu trennen, oder solche mit konventionellem und Schaltnetzteil.

Die Buchsen auf der Rückseite sind für die Ground-Noise-Dissipation in drei unterschiedliche, von einander getrennte Grupen aufgeteilt. Klangbeeinflussungen durch falsche Erdung lassen sich so effektiv unterbinden.
Inbetriebnahme
Die Inbetriebnahme des AudioQuest Niagara 3000 ist so simpel wie die Inbetriebnahme einer Mehrfachsteckdose. Abgesehen davon, dass der Niagara 3000 mehr Platz braucht, nämlich ungefähr so viel wie ein herkömmliches HiFi-Gerät. Nennenswerte Wärmeentwicklung gibt es jedoch nicht, so dass es in diesem Punkt nichts zu beachten gibt. Eine Zuleitung wird nicht mitgeliefert. Hier empfiehlt AudioQuest natürlich eines ihrer Kabel, da diese die richtigen Voraussetzungen für die Ground-Noise-Dissipation mitbringen sollen. Interessanterweise markiert AudioQuest die Phasenlage weder an den Netzkabeln noch an den hochwertigen Low-Z Power Steckplätzen des Niagara selbst. Hier muss also selbst nachgemessen werden, wenn sie wert darauf legen. Meines Erachtens lohnt sich die Mühe des Ausphasens. Sind alle Geräte an den passenden, oben beschriebenen Ausgängen angeschlossen, kontrollieren wir noch, ob der Schalter hinten auf „1“ steht und nehmen die Anlage bequem mit dem Betätigen des alleinigen Hauptschalters in Betrieb.

Die Verbindung zur Steckdose wird mit einem Kabel mit C14, umgangssprachlich „Kaltegerätestecker“ geschaffen. Der Kippschalter darüber kontrolliert die Ground-Noise-Dissipation.
In der Praxis
AudioQuest gibt an, dass der Niagara 3000 von der ersten Sekunde an eine hörbare Leistung bringt, sich aber innerhalb von zwei Wochen Dauerbetrieb noch verbessert. Ich stecke im laufenden Betrieb von dem kleinen Niagara 1200 auf den großen um, damit ich einen direkten Eindruck bekomme. Tatsächlich scheint mir der Unterschied sehr deutlich zu sein. Ich höre das zweite Album der Allman Brothers Band „Idlewild South“. Der Klang wirkt sofort etwas smoother. Vielleicht könnte man auch entspannter und natürlicher sagen. Vielleicht das, was man gemeinhin mit analoger Wiedergabe meint (natürlich höre ich Schallplatte). Im direkten Vergleich fehlt jede Schärfe im Klang. Die war zwar zuvor auch nicht vernehmbar da, ihre jetzige Abwesenheit fällt dennoch deutlich auf. Es ist schwierig zu erklären! Gleichzeitig wirkt der Klang präziser, plastischer und sortierter. Irgendwie ist es insgesamt stimmiger. Anschließend wechsele ich zum absolut herausragenden Live-Album der Truppe: „At Fillmore East“.
Die Urgewalt
Auf der Live-Platte fallen mir insbesondere die dynamischen Schlaginstrumente-Soli auf. Die Band ist mit zwei Schlagzeugern unterwegs gewesen, die beide mit üppigem Arbeitsgerät ausgestattet waren und teilweise minutenlang improvisiert haben. Mit der Transient Power Correction des Niagara 3000 wirken die Percussion-Phasen knackiger und dynamischer. Der Bassbereich scheint insgesamt konturierter und trockener zu spielen. Das bringt mich auf die Idee, mal wieder „We want Miles!“ zu hören, ein spätes Live-Album des Jazz-Trompeters. Der erste Titel „Jean Pierre“ gleicht, gut wiedergegeben, einer Urgewalt und wiedergegeben über meine Anlage, angeschlossen an den AudioQuest Niagara 3000 ist es genau das! Da wünscht man sich, mal dabei gewesen zu sein! Zurück auf den bereits guten Niagara 1200 wirkt der Klang im direkten Vergleich dagegen dumpfer in den tieferen Frequenzen und weniger fein aufgelöst in den höheren Bereichen. Für mich ist der Unterschied deutlich wahrnehmbar.

Durchdacht, effektiv und elegant ist der Niagara 3000 eine willkommene Ergänzung für hochwertige Setups.
Fazit
Der AudioQuest Niagara 3000 ist eine hochwertige Strommanagementzentrale, die hochwertigen Geräten nicht nur hohen Komfort durch die Absicherung und gemeinsame Schaltung bietet, sondern auch deutlich zum positiven Klangerlebnis beiträgt. Mit seinen Abmessungen, die ungefähr dem üblichen HiFi-Maß entsprechen, steht er mit im Rack und versorgt bis zu sieben angeschlossene Geräte mit gereinigter Energie. Dafür ist er mit einigen hauseigenen Technologien ausgestattet. Von den „Low-Z Power“-Anschlüssen über die „Linear Noise Dissipation“ und das patentierte “Ground-Noise Dissipation System“ bis zu zur „Transient Power Correction“ dienen alle Features dem guten Klang. Dabei geht es nicht darum, dass der AudioQuest Niagara 3000 den Sound der angeschlossenen Geräte verbessert. Er hilft jedoch dabei, dass die Klangperformance nicht durch Verunreinigungen im Stromnetz beeinträchtigt wird. In unserem Test gelang ihm das sehr nachvollziehbar!
Test & Text: Jonas Bednarz
Fotos: Simone Maier
Klasse: Referenzklasse
Preis-/Leistung: angemessen

Technische Daten
| Modell: | AudioQuest Niagara 3000 |
|---|---|
| Produktkategorie: | Power Conditioner |
| Preise: | 3.995 Euro |
| Garantie: | 5 Jahre (bei Registrierung) |
| Ausführungen: | Antrazit |
| Vertrieb: | AudioQuest, Rosendaal (NL) +31 156 541404 www.audioquest.com/de |
| Abmessungen (H x B x T): | 88 x 445 x 386 mm |
| Gewicht: | 11,3 kg |
| Überspanungsschutz: | 6000 V / 3000 A |
| Filterung: | Level-X Linear Transverse-Mode Filter: Über 24 dB von 20kHz bis 1GHz, linearisiert für dynamische (steigende) Leitungsimpedanz mit Frequenz (Quelle) und 10 bis 50 Ohm Last |
| Eingang: | 1 x IEC-C14 |
| Ausgänge: | 2 x Schuko „Hochstrom“ 5 x Schuko „Linear gefiltert Level-X“ |
| Max. Leistung: | 15 A / 230 V dauer, 55 A / 230 V für 25 mS |
| Lieferumfang: | 1 x Niagara 3000 1 x Anleitung 1 x Montagewinkel für Racks |
| Pro & contras: | + sehr hohe Verarbeitungsqualität + elegantes Design + Überspannungsschutz + effektive Stromfilterung + frontseitiger Netzschalter - keine |
| Benotung: | Empfehlung |
| Preis/Leistung: | angemessen |