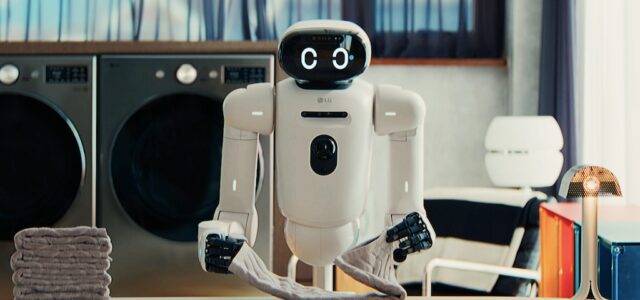Home » Tests » Audio Physic Cardeas – Mit Membran-Clou zur glänzenden Exzellenz
7. September 2025
von Volker Frech
RedakteurFrisches Flaggschiff: Audio Physic setzt bei neuen Cardeas auf ein erstaunliches Membran-Material, das die Wiedergabe dieses Referenz-Lautsprechers auf ein abermals höheres Niveau heben soll. Dieser Wunder-Werkstoff erweitert das eh schon stupende Portfolio der pfiffigen Innovationen und verblüffenden Lösungen – und als weiteren Clou dazu gibt’s nun noch einen anpassbaren Bass. Was alles in der neuen Cardeas steckt und zu welch klanglicher Exzellenz dies führt, zeigt unser Test.

Die neue Cardeas ist mit ihrer aufragenden Statur und dem gläsernen Design eine ebenso imposante wie glänzende Erscheinung.
Frisches Flaggschiff: Audio Physic setzt bei neuen Cardeas auf ein erstaunliches Membran-Material, das die Wiedergabe dieses Referenz-Lautsprechers auf ein abermals höheres Niveau heben soll. Dieser Wunder-Werkstoff erweitert das eh schon stupende Portfolio der pfiffigen Innovationen und verblüffenden Lösungen – und als weiteren Clou dazu gibt’s nun noch einen anpassbaren Bass. Was alles in der neuen Cardeas steckt und zu welch klanglicher Exzellenz dies führt, zeigt unser Test.

Der große Clou der neuen Cardeas ist das neue Membran-Material: Alle Treiber auf der Schallwand agieren nun mit einer Schwingfläche aus RecoTec. Dieser innovative Verbundwerkstoff aus Carbonfasern und Polypropylen löst das bisherige keramikbeschichtete Aluminium ab. Die Membran ist deshalb nun nicht mehr glänzend, glatt und schwarz, sondern matt, rau und graumeliert.
Imposanter Auftritt, glänzende Erscheinung
Im Design und in der Dimensionierung präsentiert sich die Cardeas unverändert: Sie ragt 1,30 Meter in die Höhe, misst 25 Zentimeter in der Breite, erstreckt sich 43 Zentimeter in die Tiefe – und macht mit diesen imposant Maßen ebenso ihren Spitzen-Status geltend wie mit ihrem stattlichen Gewicht von 63 Kilo. Trotzdem wirkt die Cardeas nicht wuchtig: Die markante und Audio Physic-typische Neigung des Korpus, die akustisch für ein zeitrichtiges Eintreffen aller Schallanteile am Hörplatz sorgt, verleiht ihr optisch eine dynamische Anmutung. Auch die Proportionen sind wohlgewählt – und natürlich punktet die Cardeas mit jener glänzenden Erscheinung, für die die Briloner Schallwandler ebenfalls längst berühmt sind: Ihr Korpus ist komplett verglast. Diesen ebenso edlen wie außergewöhnlichen Auftritt haben wir bereist bei der Avantera, der Codex, der Midex, der Avanti, der Spark und der Classic 15 bestaunt: Glas als Gehäusematerial? Dieser Werkstoff galt gemeinhin als völlig ungeeignet …
Gebändigtes Glas
… bis es Chefentwickler Diestertich gelungen ist, die akustische Härte des Materials zu bändigen. Dafür hat er ein Gehäuse mit schwingungsdämpfendem Sandwich-Aufbau entwickelt. Die Glaspaneele haben hier keinen Direkt-Kontakt mit dem dickwandigen Kern-Korpus. Sie liegen ausschließlich auf einem dicken, dauerelastische Spezial-Klebeband auf, das entlang der Korpuskanten geführt ist. Hinzu kommen flexibel gesetzte Klebepunkte an etlichen akribisch ausgesuchten Stellen der Gehäuseflächen. Die elastische Klebemasse absorbiert die Vibrationen von Gehäuse und Glas. Dieses verstärkt mit seinem hohen Gewicht sogar die bedämpfende Wirkung. Überdies funktioniert die zwischen den Glasplatten und dem Gehäuse eingeschlossene Luft wie ein Schallisolator – wie bei einem mehrfachverglasten Fenster. Die gläsernen Paneele weisen an den Kanten eine feine Fasung auf und sind mit perfektem Spaltmaß auf den Korpus gesetzt – natürlich auch auf der mit vier Glasscheiben Mosaik- oder Mondrian-artig wirkenden Front. So befördern sie, wie der edle Hochglanz und die exzellente Fertigungsqualität, den extrem hochwertigen Eindruck der Cardeas.

Die Glaspaneele der Cardeas weisen eine feine Fasung auf, alle Platten – auch die der schwarzen dreiteiligen Blende im Chassis-Bereich – haben zueinander einen perfekt gleichen Abstand. Die ausgezeichnete Fertigungs- und Materialqualität befördet die überaus hochwertige Ausstrahlung der Cardeas. Die innseitige Lackierung der Glaspaneele bewirkt dann den intensiven Hochglanz-Effekt.
Komplexe Konstruktion
Unser Vorab-Testmodell ist in einer Zebrano-Holzoptik gehalten. Dieses Design hat es jedoch nicht in das Serien-Portfolio geschafft. Standardmäßig wird die Cardeas nunmehr in den Glas-Varianten Weiß, Schwarz und Anthrazit angeboten. Durch die innseitige Lackierung des Glases entsteht der farbintensive, herrliche High Gloss-Look. Auf Anfrage und gegen Aufpreis sind darüber hinaus auch Wunschfarben realisierbar und sogar spezielle Drucke oder individuelle Muster machbar. Alternativ ist die Cardeas in Hochglanz-lackiertem Echtholz-Furnier erhältlich. Hierfür wird das Gehäuse wahlweise mit schwarzem Ebenholz oder Rosenholz verziert. Egal, welche Variante man wählt: Unveränderbar ist die im Chassis-Bereich magnetisch auf der Front haftende und damit abnehmbare Glasblenden-Einheit, die eigentlich aus drei separaten schwarzen Paneelen gefügt wird. Ist schon dieser Aufbau komplex, so wird es beim Kern-Korpus noch ausgefuchster: Das Gehäuse besteht aus dickwandigem MDF sowie Sandwich-Platten mit Waben-Kern. Dank ihrer Honeycomb-Struktur und einer teilweise zusätzlich aufgeklebten dämpfenden Gewebebeschichtung sind diese Spezial-Platten hochgradig steif und schwingungsresistent.
Kammerspiel im Korpus
Diese speziellen Honeycomb-Sandwich-Platten strukturieren auch das Innere der Cardeas: Ihr Gesamtvolumen ist durch zahlreiche Wabenkern-Paneele in zwölf verschieden große Kammern asymmetrisch unterteilt. Durch die zahlreichen Längs- und Querverstrebungen wird abermals die seismische Stillegung befördert. Zudem spielen so alle frontseitigen Chassis auf ihr eigenes Volumen. Dieses erstaunliche Kammerspiel wird nun mit einem weiteren Spezial-Werkstoff optimiert: Keramikschaum. Dieses leichte, ultraharte und offenporige Material besitzt eine schwammartige Struktur, besteht somit zum Großteil aus Luft und besitzt eine extrem große Oberfläche. Diestertich hat die akustische Wunderwirkung dieses Keramikschaums erkannt und nutzt sie gleich doppelt: Blöcke dieses porenreichen Materials dienen in diversen Kammern, ohne dass sie dort klangrelevantes Volumen reduzieren, als dämpfende Diffusoren für den Schall, den die Chassis rückwärtig in das Gehäuseinnere abstrahlen. Keramikschaum-Elemente sind aber ebenso an genau definierten Durchbrüchen zwischen den Gehäusekammern platziert und bewirken hier als sogenannter Fließwiderstand einen ebenso definierten Luftdurchlass. So hat Diestertich auch das Bassvolumen ventiliert: Bodenseitig …

Das Flaggschiff aus Audio Physics Reference Line beeindruckt mit straff-aufstrebender Formgebung und dem dynamisch nach hinten geneigten Korpus. Hier ist der Lautsprecher in Zebrano-Holzoptik realisiert.
Bassreflex-Besonderheiten
… besteht die Cardeas großenteils aus Keramikschaum. Hier ist er Teil einer speziellen Bassreflex-Abstimmung, besser: eines Bandpasses, der zudem die Bildung einer Resonanzspitze im Bass verhindert. Das porenreiche Material sitzt ebenso in einem vorderseitigen Durchlass. Die hier austretende Luft wird dann durch den Hohlraum, der zwischen MDF-Korpuswand und Glas-Verkleidung existiert, nach unten geführt und entweicht ebenfalls bodenseitig. Diese Doppel-Downfire-Lösung der Bassreflex-Abstimmung vermeidet hässliche Port-Löcher im Gehäuse und ermöglicht eine homogenere Abstrahlung dieser Bassanteile. Das erlaubt im Gegensatz zu einer rückseitigen Portführung auch eine wandnähere Aufstellung. Doch wo sind nun die Tieftöner? Sie sind unsichtbar im Innern des Korpus versteckt und hier in einem abermals eigenen Gehäuse untergebracht. Dort stehen sie, längsseitig platziert. mit einander zugewandten Membranen. Die beiden Woofer arbeiten im Push-Push-Modus. Durch das zeitgleiche Aufeinanderzu- und Auseinanderbewegen der Membranen heben sich ihre mechanischen Schwingungsimpulse auf, die sonst auf die Chassis-Körbe wirken und infolge den gesamten Lautsprecher vibrieren lassen würden.
Bassreflex-Besonderheiten
… besteht die Cardeas großenteils aus Keramikschaum. Hier ist er Teil einer speziellen Bassreflex-Abstimmung, besser: eines Bandpasses, der zudem die Bildung einer Resonanzspitze im Bass verhindert. Das porenreiche Material sitzt ebenso in einem vorderseitigen Durchlass. Die hier austretende Luft wird dann durch den Hohlraum, der zwischen MDF-Korpuswand und Glas-Verkleidung existiert, nach unten geführt und entweicht ebenfalls bodenseitig. Diese Doppel-Downfire-Lösung der Bassreflex-Abstimmung vermeidet hässliche Port-Löcher im Gehäuse und ermöglicht eine homogenere Abstrahlung dieser Bassanteile. Das erlaubt im Gegensatz zu einer rückseitigen Portführung auch eine wandnähere Aufstellung. Doch wo sind nun die Tieftöner? Sie sind unsichtbar im Innern des Korpus versteckt und hier in einem abermals eigenen Gehäuse untergebracht. Dort stehen sie, längsseitig platziert. mit einander zugewandten Membranen. Die beiden Woofer arbeiten im Push-Push-Modus. Durch das zeitgleiche Aufeinanderzu- und Auseinanderbewegen der Membranen heben sich ihre mechanischen Schwingungsimpulse auf, die sonst auf die Chassis-Körbe wirken und infolge den gesamten Lautsprecher vibrieren lassen würden.

Ohne das Glaspaneel, das die Chassis einfasst, bekommt man einen Eindruck von der Aufwändigkeit der Gehäusefertigung, der Chassis-Konstruktion und der Befestigungstechnik. All dies dient der Vermeidung und Neutralisierung von klangschädlichen Vibration. Deshalb thront der Tweeter auch auf einer eigenen, vom Gehäuse entkoppelten Platte.
Trickreiche Tieftöner
Die längsseitige Woofer-Platzierung im Innern sorgt für einen schlanken Lautsprecher ohne Löcher in den Flanken – und ermöglicht zugleich einen kraftvollen Bass, weil gleich zwei Tieftöner mit reichlich Membranfläche agieren. Aber wie, bitteschön, passen zwei Woofer in den Korpus? Diestertich setzt auf auch hier auf außergewöhnliche Chassis: Jeder Tieftöner agiert mit einer 28 Zentimeter durchmessenden Membranen, die aus Aluminium besteht. Verblüffend ist nun das Design dieser Schwingfläche: Die Formgebung erinnert an eine umgestülpte Schüssel. Diese Schüssel überwölbt nun den gesamten Antrieb, statt wie eine normale Konus-Membran vor ihm zu stehen. Durch diesen Kniff sind die Woofer ungemein schlank: Sie weisen eine Komplett-Einbautiefe von nicht mal acht Zentimetern auf. Trotzdem sind die Wunder-Flundern ausgewiesene Bass-Spezialisten. Sie punkten trotz Flachbauweise mit langem linearen Hub und somit großem gleichmäßigen Auslenkvermögen. Im Zusammenspiel mit der Bassreflex-Abstimmung verhilft das Woofer-Duo der Cardeas zu einem kraftvollen Bass, der mit einem Tiefst-Gang bis 23 Hertz beeindruckt.
Zweistufige Bass-Anpassung
Dieser Tiefton kann nun verändert werden – und damit sind wir bei einer der beiden grundlegenden Novitäten der Cardeas: der Anpassbarkeit des Basses. Dies erreicht Diestertich mit abermals ausgefuchster Technik: Die beiden Woofer wie auch die zwei Mitteltieftöner besitzen nicht nur wie üblich eine Schwingspule, sondern jetzt gleich zwei. Die neue Doppelschwingspule ermöglicht eine induktiven Kopplung: Durch sie lassen sich Wirbelströme, die unvermeidbar durch die Schwingspulen-Bewegungen im Magnetsystem entstehen, verringern. Diese Wirbelstrom-Bremse lässt sich mit den rückseitigen Schaltern anpassen: Mit den Stellungen „0“ (High), „I“ (Mid) und „II“ (Low) wird die Güte der induktiven Dämpfung verringert und der Einfluss der zweite Schwingspule in zwei Stufen herabgesetzt. So lässt sich der Bass verändern, um etwa eine wand- oder ecknahe Aufstellungen zu ermöglichen. Durch separate Schalter für Mitteltieftöner und Tieftöner ist diese Anpassung überaus vielseitig. Das Bass-Management gelingt dabei mit nahezu unveränderter Impedanz. Diese Last-Stabilität weiß jeder vorgeschaltete Verstärker sehr zu schätzen.

Das Anschlussfeld der Cardeas: Hier finden wir, neben den höchstwertige WBT-Klemmen aus der nextgen-Serie, auch auch die Kippschalter für die Bassanpassung. Das gesamte Terminal ist mehrfach vibrationsentkoppelt: Die Tafel ist rückseitig mit einer schwingungsabsorbierenden Gummischicht ausgestattet. Die Schrauben sind, wie wir es schon bei den Chassis gesehen haben, in Kunststoffdübel eingedreht. Die beiden Klemmen sind über eine elastische Kunststoffeinfassung von der Platte entkoppelt.
Innovatives Membran-Material
Kommen wir endlich zu den Chassis auf der Front – und damit zur bedeutendsten Veränderung bei der neuen Cardeas: Die Membranen aller vier Treiber bestehen aus einem völlig neuen Material. Viele Jahren lang war für Diestertich Aluminium die bestmögliche Lösung: Härte und Steifigkeit gestatteten eine Akkuratesse und Auflösung, die mit Papier nicht erreichbar war. Andere harte Hitech-Materalien wiederum konnten Diestertich nie überzeugen: So kamen etwa Kohlefaserverbundwerkstoffe nicht infrage, weil die Kombination aus Kunstharz und regelmäßiger Carbon-Faserstruktur resonanzanfällig ist. Doch auch Aluminium hat seine Kniffeligkeiten und ist nicht das Nonplusultra. Das könnte für Diestertich nun seine neuen Werkstoff-Entdeckung sein: RecoTec. Er besteht aus einem Kohlefasergelege, bei dem die Fibern völlig chaotisch angeordnet sind – ähnlich wie bei Papier. Dieses konfuse Carbonfasergelege wird in eine hochreine Polypropylen-Matrix eingebettet. Diese Kunststoffmatrix hat die Aufgabe, die Verstärkungsfasern einzubinden und zu fixieren. Hierfür sind weder Klebstoffe noch Kunstharze nötig, so können keine störenden Resonanzen entstehen.
Wunder-Werkstoff mit Mehrfach-Meriten
Der gewünschten Härtegrad dieses Kohlefaser/Kunststoff-Verbunds wird allein durch das thermische Produktionsverfahren erreicht, also mit Hitze und Druck. Das so erschaffene RecoTec hat nun fundamentale Vorteile: Mechanisch ist es druckresistenter als Alu, welches eine unsanfte Berührungen gerne mal mit Beulenbildung quittiert. Klanglich steht RecoTec dann für eine Symbiose: Es ermöglicht einerseits die Präzision und Auflösung einer modernen Aluminiummembran und sorgt andererseits für jene Natürlichkeit und Substanz im Grundton, für die Schwingflächen aus klassischem Papier bekannt sind. So bietet RecoTec das Beste aus zwei Welten – und glänzt dabei mit absoluter Resonanzarmut. Audio Physic-Chefentwickler Diestertich, der nun wirklich nicht zu Übertreibungen und Marketing-Sprech neigt, ist von diesem Wunder-Werkstoff regelrecht begeistert: Er erkennt in RecoTec „das Membranmaterial der Zukunft“. Optisch mutet der matte, graumelierte Verbundwerkstoff mit seinem chaotischen Faserverlauf wie eine Verbindung von Filz und Papier an, auch haptisch fällt die angenehme Rauheit der Oberfläche auf.

Der untere der beiden Mitteltieftöner: Diese Treiber übernehmen den Bereich von 100 bis 300 Hertz. Der Clou dieses Chassis ist fürs Auge versteckt: Der Mitteltieftöner agiert ohne Zentrierspinne. Stattdessen ist er einem zweiten Konus ausgestattet, der hinten an die frontale Membran angesetzt ist und mit einer zweiten Sicke an den Chassis-Korb angedockt ist.
Mitteltieftöner mit pfiffiger Doppelsicke
Die an dieser innovativen Membran haftende weitere Neuerung ist da eher eine Neben-Novität: Bei allen Front-Chassis besteht die aus Synthesekautschuk gefertigte Sicke statt aus SBR nun aus EPDM, was bei gleichem messtechnischen Verhalten klanglich zu mehr Details und weniger Kompressionseffekten führt. Bei den beiden Mitteltieftönern der Cardeas kommen nun gleich zwei Sicken zum Einsatz, um die energievernichtende und impulsbremsende Zentrierspinne zu vermeiden. Dies hat Diestertich mit einer weiteren ausgebufften Lösung realisiert: Die Mitteltieftöner-Membranen sind eigentlich Doppelkegel. An die Rückseite der Haupt-Membran wird ein zweiten Konus angesetzt, der mit einer eigenen Sicke an den alles haltenden Chassis-Korb angebunden ist. Mit dieser Doppelsicken-Lösung agieren die beiden spinnenfreien Mitteltieftöner, die von den unsichtbaren Woofern bei rund 100 Hertz die Schallwandlung übernehmen, bis etwa 300 Hertz. Da beide Mitteltieftöner dieses Frequenzsegment abdecken, addieren sich ihre Membranen de facto zu einer großen resultierenden Schwingflächen. Das führt zu einer kräftigeren Wiedergabe dieses Frequenzbereichs.
Mitteltöner mit spinnenfreier Spezialmembran
Ab 300 Hertz übernimmt dann der Mitteltöner. Er agiert zugunsten größerer Flottheit und höheren Wirkungsgrads ebenfalls spinnenfrei. Hier sieht Diestertichs Lösung aber anders aus: Stabilisierung und Zentrierung der Membran obliegen allein einer einzigen Sicke. Zur Bewältigung dieser Maximalanforderung ist diese Randeinfassung speziell realisiert: Die mit der Membran verklebte, U-förmige Flachsicke wird hinterseitig mit einem Spannring aus Aluminium versehen, der im Durchmesser geringfügig größer ist. Das ähnelt dem Aufziehen eines Auto-Reifens. Mit dieser permanent vorgespannten Sicke wird die Membran in Position gehalten. Bei der Membran ist neben dem Material auch die Formgebung frisch: Sie besitzt zugunsten einer höheren Stabilität nun eine flachere Geometrie mit dafür stärkerer Wölbung hin zum Zentrum. Hier sitzt mit dem Phase Plug die nächste Modifikation: Er besteht nicht mehr aus klingelanfälligem Metall, sondern aus schwingungsunemempfindlichem Kunststoff. Dies ermöglichte der Wechsel des Magnetmaterials: Der Antrieb arbeitet nun mit Ferrit statt mit Neodym, dadurch entfällt die Notwendigkeit zur Kühlung.

Der Mitteltöner übernimmt den Frequenzbereich von 300 bis 2.900 Hertz. Auch er agiert ohne Zentrierspinne. Sämtliche Stabilisierungs- und Zentrierungsaufgaben meistert allein eine vorgespannte Spezialsicke. Die markant flache Membran resultiert ebenfalls aus dieser Spinnenlosigkeit. Der Mitteltöner vollführt dadurch einen etwas geringeren Hub, gewinnt durch die Befreiung von der hinteren Zentrierung aber an Impulstreue und Wirkungsgrad.
Hochtöner mit frappantem Konus
Bei rund 2,9 Kilohertz übernimmt dann der Hochtöner. Auch er ist natürlich mit dem neuen Membran-Material ausgestattet, erweist sich ansonsten jedoch als jene längst für Audio Physic typische Diestertich-Delikatesse, die schon in anderen Reference Line-Modellen Einzug gehalten hat: Hier agiert keine konventionelle Kalotte, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint, sondern ein Konus-Lautsprecher mit relativ kleiner, leicht gewölbter Konus-Membran und ziemlich großer Kunstseide-Kappe als zentralem Staubschutz. Mit diesen erstaunlichen Dimensionierung schallwandelt der Hochtöner mit sehr geringen Verzerrung bei hohem Wirkungsgrad. Die Membran schwingt dabei ohne jene Taumelbewegungen, für die ihre kalottigen Schwestern anfällig sind. Die bemerkenswerten Größenverhältnisse treiben dem Tweeter die notorischen Konus-Kniffligkeiten aus: Normalerweise bündelt ein solches Chassis stärker den Schall und ist empfindlicher für Resonanzen. Diese Nachteile hat Diestertich mit seiner Neukonstruktion behoben – und dabei die Konus-Vorteile bewahrt. So agiert dieser 29-Millimeter-Tweeter verzerrungsarm, mit homogener Schallabstrahlung und großer Linearität bis hin zu stratosphärischen 40 Kilohertz.
Vibrations-Stopp in allen Teilen
Damit der Hochtöner diese Aufgabe ohne externe Vibrationseinflüsse erfüllen kann, thront der Tweeter auf einer eigenen, vom Gehäuse entkoppelten Montageplatte. Hier isoliert ihn zusätzlich ein dämpfender Schaumstoffring, der zwischen Platte und Chassis sitzt. Die hier und bei der gesamten Korpus-Konstruktion betriebene Verhinderung und Neutralisierung klangschädlicher Vibrationen setzt sich bei der Cardeas in eigentlich allen Teilen fort. So agieren die Mittel- und Mitteltieftöner in einem Doppelkorb: Der äußere ist ein Stabilität-stiftendes Aluminiumdruckguss-Gebilde, der innere eine Kunststoff-Konstruktion, die dank ihrer Dämpfungseigenschaften die Absorption aller Materialschwingungen bewirkt. Beide Körbe haben nur punktuelle Kontaktflächen und sind quasi voneinander entkoppelt. Zur Vibrationsberuhigung werden sämtliche Schrauben nicht direkt in den Korpus eingedreht, sondern in dämpfende Neopren-Dübel. Korpus und Fuß-Traversen sind durch Honeycomb-Platten voneinander isoliert. Die Schwingungs-Entkopplung vom Untergrund besorgen schließlich Audio Physics VCF Magnetic Plus-Unterstellfüße. Ihre im Innern zweiteilige Konstruktion besitzt zwei starke, sich gegenseitig abstoßende Magnete. Dank diese Quasi-Kontaktlosigkeit schwebt die Cardeas förmlich überm Boden.

Der Hochtöner könnte glatt eine Kalotte sein, ist aber ein Konus-Lautsprecher mit relativ kleiner Membran und verhältnismäßig großer Staubschutzkappe. So agiert der Tweeter taumelfrei bis hin zu staunenswerten 40 Kilohertz. Um dieses Performance-Potenzial auch vollständig nutzen zu können, erfolgt die Verkabelung mit ausgewiesenen Audio-NF-Leitungen. Die Filz-Einfassung des Tweeters mit Filz trägt zur Bedämpfung der aufgesetzten Glasblende bei und kaschiert die Durchbohrungen, welche der Belüftung des Hochtöners dienen und überdies Kompressionseffekte verhindern.
Die Audio Physic Cardeas in der Praxis
Zum Aufstellungsort muss man die gewichtigen Lautsprecher aber trotzdem tragen. Das erledigt man auf jeden Fall zu zweit. So schwer die Cardeas ist, so leicht macht sie uns dann die Platzierung. Hier verhält sich das Flaggschiff wie alle Audio Physic-Schallwandler, die wir bereits kennengelernt haben. Wir brauchen wegen der Downfire-Bassreflex-Abstimmung nur einen üblichen Wandabstand von gut 40 Zentimetern einhalten. Lautsprecher und Hörplatz bilden ein ungefähr gleichschenkliges Dreieck mit einer Seitenlänge von rund 2,50 Meter. Die Lautsprecher positionieren wir, wenn es geht, grundsätzlich ohne Einwinklung zum Hörplatz. Das klappt auch bei der Cardeas vorzüglich. Wir haben sie an unseren kraftvollen Vollverstärker Hegel H360 angeschlossen. Er empfängt die Musik von der Streaming-Vorstufe Lumin P1 Mini. In Ihrer App haben wir als Musikdienst Qobuz implementiert. So streamen wir für die Aufstellung und Ausrichtung Shelby Lynnes wundervolle Version des Dusty Springfield-Songs „Just A Little Lovin‘“ – und prompt klappt uns der Kiefer runter:
Akustische Offenbarung
Ab dem ersten Ton ist die Wiedergabe eine akustische Offenbarung! Dabei beginnt die Nummer eigentlich ziemlich unspektakulär: Drummer Gregg Field berührt mit seinem Stick nur zweimal behutsam sein Ride-Becken, versetzt der Bassdrum einen sanften Tritt, gibt das Achtel-Tempo dezent mit der geschlossenen Hi-Hat vor und vollführt zu Beginn der zweiten Takthälfte einen Rim-Click auf der Snare, bei dem insbesondere der Metallrand der Rasseltrommel leicht angeschlagen wird und das Fell mit der Schlaghand zugleich abgedämpft wird. Warum wissen wir, was Field da treibt ? Weil die Cardeas uns alles bis ins allerfeinste und kleinste Detail hören lässt und dieses Drumset derart realistisch abbildet, dass wir Gregg Field förmlich beim Schlagzeugspielen zusehen erkennen können. Wir erleben eine famose Materialität: Wir nehmen das Holz der Sticks war, und ebenso das Metall des Ride-Beckens, das nach dem Anschlagen faszinierend im Ton changiert, weil sich beim Ausklingen fortwährend das Frequenzspektrum des vibrierenden Metalls ändert.
Immersive Abbildungskraft
Auch Fields Bassdrum-Betätigung lässt uns staunen: Bei dem eigentlich leichten Tritt spüren wir bereits den knackigen, trockenen Druck, den eine solche große Trommel entfaltet. Wir nehmen ihr Volumen war – und erkennen wegen der Präzision und Feinauflösung sogar die Bewegung dieses Trommelfells. Dank der exzellenten Auflösung ändern sich auch auf Anhieb die räumlichen Verhältnisse: Unser reales Hörzimmer ist irrelevant. Stattdessen sitzen wir im geräumigen Studio, weil die Cardeas den Hall des Aufnahmeraums mit allen Wandreflexionen in geradezu immersiver Abbildungskraft erfahrbar macht. Die Snare wurde zusätzlich mit einem großen Kathedralen-Hall unterlegt, dieser intensive Effekt vermittelt uns grandios eine schier grenzenlose Breite und Tiefe der Wiedergabe. Wir verspüren beim Hören ein herrliches Gefühl von Weite und Offenheit, Freiheit und Luftigkeit. Dies bleibt auch so mit dem Einsatz der anderen Instrumente, denn die Cardeas agiert mit herrlicher Klarheit und Transparenz. So hat jedes Instrument allen erdenklichen Freiraum, um sich zu entfalten.

Die Cardeas steht sicher auf zwei Metalltraversen. Die Entkopplung vom Boden besorgen die mitgelieferten VCF V Magnetic Plus-Füße, die im Innern mit sich gegenseitig abstoßenden Magneten ausgestattet sind.
Mühelose Mächtigkeit
Bei den hinzutretenden Instrumenten zaubert uns insbesondere der Bass ein Grinsen ins Gesicht: Kevin Axt spielt erst einen lang liegenden Ton, der mit immensem Tiefgang und anstrengungsloser Kraft den gesamten Raum flutet und das Zimmer mit stupender Tragfähigkeit bis in den hintersten Winkel füllt. Dann lässt Axt einen zweiten, sofort abgestoppten Ton folgen, der mit seinem Schub druckvoll unseren Magen und unser Trommelfell massiert. Was für eine mühelose Mächtigkeit! Dabei ist dieser Bass – wie auch schon das Schlagzeug – frei von jeglichen Kompressionseffekten, die sonst gerne bei dynamischen Spitzen und kraftfordernden Tiefton-Anteilen die Realitäts-Grenzen einer Wiedergabe aufzeigen. Dazu ist der Bass absolut definiert und konturiert: Wir hören sogar, wie Axt beim Greifen mit den Fingern über die umsponnenen Stahlsaiten rutscht und die dicken Trosse mitunter den Hals und die Bundstäbchen touchieren. Auch hier erleben wir eine Plastizität der Abbildung, als stünde Kevin Axt mit seinem Fünfsaiter direkt vor uns.
Grandiose Klarheit
Dank dieser bestens aufgeräumten Wiedergabe sind auch die Melodie- und Harmonieinstrumente ein Hochgenuss: Bei Gitarrist Dean Parks hören wir jeden Hammering-Effekt seiner Greifhand samt Fingervibrato, wodurch die Akkorde eine ganz eigene Klangfarbe entwickeln. Wir vernehmen neben seinem Spiel sogar das Rauschen seines Röhrenverstärkers, über den er die E-Gitarre spielt – mehr Livehaftigkeit geht kaum. Dies rundet Rob Mathes mit geschmackvollen Akkord-Anreicherungen auf dem Keyboarder ab, ohne dass Gitarrenklänge und Klaviertöne verschwimmen. Die Definition und Klarheit der Instrumente ist grandios! Zudem platziert die Cardeas alle Musiker in herausragende Breiten- und Tiefenstafflung auf der imaginierten Bühne. Das gilt insbesondere für Shelby Lynne. Die amerikanische Sängerin vermittelt mit ihrer schlanken, weichen Stimme eine Intimität, als wären wir ihr ganz nah Lynne singt verhalten, sanft, verletzlich, als wäre sie wirklich, wie sie singt, gerade am Morgen erwacht – und wir hören jede noch so kleine Wendung ihres Gesangs bis hin zu den zartesten Atemzügen.
Frappanter Unterschied
Im Ganzen ist diese Wiedergabe so harmonisch, stimmig, entspannt und selbstverständlich, dass diese grundsätzliche Performance-Steigerung uns ein wenig verblüfft. Wir haben von Audio Physic auch eine Midex in der Redaktion, die noch mit den Aluminium-Membranen ausgestattet ist. Sie schließen wir nun zum Vergleich mal an. Das ist sicher nicht fair, weil es – abgesehen von den Membran-Unterschieden – natürlich etliche andere Faktoren wie etwa die geringere Größe oder die differierende Treiber-Anzahl gibt, durch die sich die Midex von der Cardeas unterscheidet. Trotzdem scheint insbesondere das andere Membran-Material den frappanten Unterschied zu machen: Mit den RecoTec-Schwingflächen klingt die Musik im Vergleich derart sonorer und runder, lebendiger und intensiver, natürlicher und echter, dass wir schnell wieder zur Cardeas zurückkehren. Uns fallen prompt auch die feinere Auflösung und die gesteigerte Darstellungskraft auf – sowohl bei der Plastizität der Musiker als auch bei der Dreidimensionalität von Bühne und Räumlichkeit.

Der Kopf der Cardeas: Die mehrteilige schwarzen Glasblende strukturiert die Front und kaschiert den Versatz aller Chassis, die exzentrisch auf der Schallwand positioniert sind.
Wanderung durch den Klangkörper
Das zahlt sich auch im musikalischen Großformat aus – etwa bei der Arie „Addio del passato“ aus Verdis „Traviata“: Das Orchestra Sinfonica Nazionale Della RAI eröffnet diese wunderbare Musik mit einer mitten im Musikerverbund sitzenden wehmütigen Oboe, auf sie antworten die davor positionierten Geigen und Violen, während die Kontrabässe rechts vorne das Fundament liefern. Wir können mit unseren Ohren förmlich durch diesen Klangkörper wandern. Auch dank der über die Mikrofone eingefangene Raumakustik sitzen wir prompt im Turiner Auditorium Toscanini RAI, in dem diese Aufnahmen stattgefunden hat. Hier singt nun Nadine Sierra mit einer derartigen Gegenwärtigkeit, dass wir völlig gebannt ihrem herrlichen Sopran zuhören: Die junge Amerikanerin betört uns mit ihrer strahlenden Stimme, zieht alle Register der Gesangskunst, wechselt mühelos die Register, erreicht mit Leichtigkeit die Spitzentöne, die sie mit feinem Vibrato veredelt. Ihre Klage hat eine derartige Innigkeit und Intensität, dass wir bei den zarten Passagen unwillkürlich den Atem anhalten.
Präzision und Power
Die Cardeas kann aber natürlich auch ganz anders: Bei „Never Mind“ von den Infected Mushroom haut sie uns die ultraharten und hochgetakteten Beats des Psy-Trance-Duos mit Präzision und gnadenloser Power um die Ohren. Während wir vom Schub, Druck und Punch ins Sofa gedrückt werden und die brachialen Bässe unsere Hosenbeine zum Flattern bringen, bleibt die Cardeas völlig unbeeindruckt. Trotz sattestem Pegel liefert sie eine absolut aufgeräumte Wiedergabe, in der auch das Dauergewitter an elektronischen Sounds und Samples glasklar zu hören ist. Diese Vollbedienung bietet die Cardeas natürlich auch bei handgemachter Musik: Beim „Arabian Desert Groove“ zünden Drum-Legende Charlie Antolini und Percussion-Koryphäe Nippy Noya ein regelrechtes Schlagwerk-Feuerwerk. Wir zucken dank der explosiven Dynamik und der herausragenden Akkuratesse, die die Cardeas bietet, bei jeder Trommel, jedem Becken und jedem Schellen-Schlag zusammen. Darunter spielt Wolfgang Schmid stoischen einen mördertiefen Bass, dessen Gewaltigkeit ohne Kompressionseffekte am gesamten Körper physisch erfahrbar ist. Uff!
Nuancierte Bassanpassung
Mit dieser immensen Power, dieser fulminanten Dynamik und diesem mächtigen Bass liefert die Cardeas eine im wahrsten Sinn des Wortes atemberaubende Wiedergabe – selbstverständlich auch in größeren Räumen. Was ist aber nun, wenn man die Lautsprecher näher an die Wand rücken möchte oder der Raum eh schon die Bässe überbetont? Dafür hat die neue Cardeas ja die Anpassungsschalter auf der Rückseite, die wir nun ausprobieren. Dafür rücken wir die Lautsprecher nah an die Wand. Wie erwartet, ist der Bass nun zu prononciert und verliert auch jene wunderbare Konturiertheit und Straffheit, mit der die Cardeas bei allem Tiefgang souverän agiert. Mit den verschiedenen und separaten Schalterstellungen für Mitteltiefton und Bass gelingt nun durchaus eine Wiederannäherung an die klangliche Balance, hier sollte man mit den verschiedenen Möglichkeiten spielen. Trotzdem bleibt unser Favorit die „0“-Stellung mit etwas größerem Wandabstand. So bietet die Cardeas ihre optimale Performance – und die ist schlicht überragend.

Die Audio Physic Cardeas im Hörraum: Hier spielt sie mit der Streaming-Vorstufe Lumin P1 Mini und der Endstufe Galion TS A75. Auch in dieser Komponenten-Kombination bietet der Referenz-Lautsprecher eine Performance vom Feinsten.
Fazit
Audio Physic setzt bei neuen Cardeas auf ein erstaunliches Membran-Material – und dies hebt die Performance dieses Referenz-Lautsprechers wirklich auf ein abermals höheres Niveau. Die Wiedergabe punktet mit exzellenter Auflösung, herrlicher Klarheit und Transparenz. Der Detailreichtum ist schlichtweg großartig. Dadurch haben die Musiker und ihre Instrumente eine Präsens und Plastizität, die geradezu frappant ist. Auch die dreidimensionale Darstellung ist mit ihrer immersiven Wirkung überragend. Der imaginierte Raum hat eine schier grenzenlose Breite und Tiefe, die Abbildung glänzt mit herrlicher Luftigkeit und Offenheit. Mit ihrer fulminanten Fein- und Grobdynamik bietet die Cardeas eine mitreißende Wiedergabe. Hierzu trägt auch die Kompressionsfreiheit bei. Sie reicht bis in den abgrundtiefen, absolut aufgeräumten Bass, der mit mühelose Mächtigkeit beeindruckt. Mit dem neuen Membran-Material erreicht die Cardeas dabei eine verblüffende Steigerung: Die Wiedergabe gewinnt deutlich an Natürlichkeit, Lebendigkeit und Stimmigkeit und sorgt für ein noch intensiveres Wie-echt-Erlebnis. Mit diesem Membran-Clou steht die Cardeas optisch wie akustisch für glänzende Exzellenz.
Test & Text: Volker Frech
Fotos: Simone Maier
Klasse: Referenzklasse
Preis/Leistung: gut
100 of 100
100 of 100
99 of 100

Technische Daten
| Modell: | Audio Physic Cardeas |
|---|---|
| Produktkategorie: | Standlautsprecher |
| Preis: | - Glas (Weiß, Schwarz, Anthrazit): 38.990,00 € / Paar - Hochglanz-lackiertes Echtholz-Furnier (schwarzes Ebenholz, Rosenholz): 42.890,00 € / Paar - Spezial-Drucke/Muster (Glas) und Sonderlackierungen: auf Anfrage, gegen Aufpreis - Upgrades der alten Modell-Version: auf Anfrage, gegen Aufpreis |
| Garantie: | - 5 Jahre ohne Registrierung - 10 Jahre mit Registrierung |
| Ausführungen: | - Glas: Weiß, Schwarz, Anthrazit - Hochglanz-lackiertes Echtholz-Furnier: schwarzes Ebenholz, Rosenholz andere Ausführungen auf Anfrage |
| Vertrieb: | Audio Physic GmbH, Brilon Tel.: +49 2961 961 70 www.audiophysic.com |
| Abmessungen (HBT): | Abmessungen (HBT): - 1230 x 250 x 430 mm (ohne Traversen und Füße) - 1280 x 480 x 480 mm (mit Traversen und Füßen) - Grundfläche (BxT): 490 x 580 mm |
| Gewicht: | - Glasversion: ca. 45 kg / Stück - Holzversion: ca. 39 kg / Stück |
| Bauart: | 4-Wege, passiv, Bassreflexabstimmung |
| Impedanz: | 4 Ω |
| Hochtöner: | 1 x HHCT V+ (39 mm, Konus, RECOTec-Membran) |
| Mitteltöner: | 1 x HHCM SL V+ (150 mm, Konus, RECOTec-Membran) |
| Mitteltieftöner: | 2 x 180 mm, Konus (RECOTec-Membran) |
| Tieftöner: | 2 x 280 mm (innenliegende Woofer mit Aluminium-Membran) |
| Frequenzbereich: | 23 Hz - 40 kHz (Herstellerangabe) |
| Trennfrequenzen: | 100 Hz / 300 Hz / 2,9 kHz (Herstellerangabe) |
| Wirkungsgrad: | 89 dB (Herstellerangabe) |
| Empfohlene Verstärkerleistung: | 40 - 350 W |
| Lieferumfang: | - Audio Physic Cardeas - Glasblende - 8 VCF V Magnetic Plus Speaker-Unterstellfüße - 8 Rondelle zur Konterung der Unterstellfüße - Urkunde mit Bestätigung der Fertigungskontrolle und der akustischen Prüfung - Bedienungsanleitung |
| Optionale Upgrades: | Bi-Wiring/Bi-Amping-Terminal |
| Upgrades alter Modell-Version: | 1) Austausch Hochtöner + Mitteltöner 2) Austausch Hochtöner + Mitteltöner + Tiefmitteltöner 3) Austausch aller Treiber incl. Einziehen eines 2. Kabelstrangs |
| Pros und Contras: | + neues Membran-Material sorgt für noch größere Natürlichkeit, Lebendigkeit und Stimmigkeit + herausragende Klarheit und Transparenz + superbe Darstellungskraft mit herausragender Plastizität und Materialität + immersive räumliche Abbildung mit exzellenter Dreidimensionalität + wunderbare Offenheit, Luftigkeit und Weiträumigkeit der Wiedergabe + kolossale Akkuratesse und Agilität aufgrund der großen Impulstreue + herrliche Feinstauflösung + kolossaler Detailreichtum + fulminante Dynamik + beeindruckend tiefreichender, mächtiger, souverän-konturierter Bass + stupend kraft- und druckvolle Performance + harmonisch-stimmige Wiedergabe, ermöglicht entspannten Musikgenuss + unproblematisch Aufstellung + Downfire-Bassreflexabstimmung und Bass-Anpassungsoptionen ermöglichen wandnahe Aufstellung + High Gloss-Effekt mit intensivem Farbton + vorzügliche Verarbeitung + gut erklärende Bedienungsanleitung - keine Stoffblende im Lieferumfang |
| Benotung: | |
| Klang (60%): | 100/100 |
| Praxis (20%): | 100/100 |
| Ausstattung (20%): | 99/100 |
| Gesamtnote: | 100/100 |
| Klasse: | Referenzklasse |
| Preis/Leistung: | gut |
| Getestet mit: | - Vollverstärker: Hegel H360 - Streaming-Vorstufe: Lumin P1 Mini - Signalkabel: Audioquest Black Beauty RCA - Lautsprecherkabel: Audioquest Rocket 88 Single Wire - Netzkabel: Audioquest Monsoon - Streamingdienst: Qobuz |